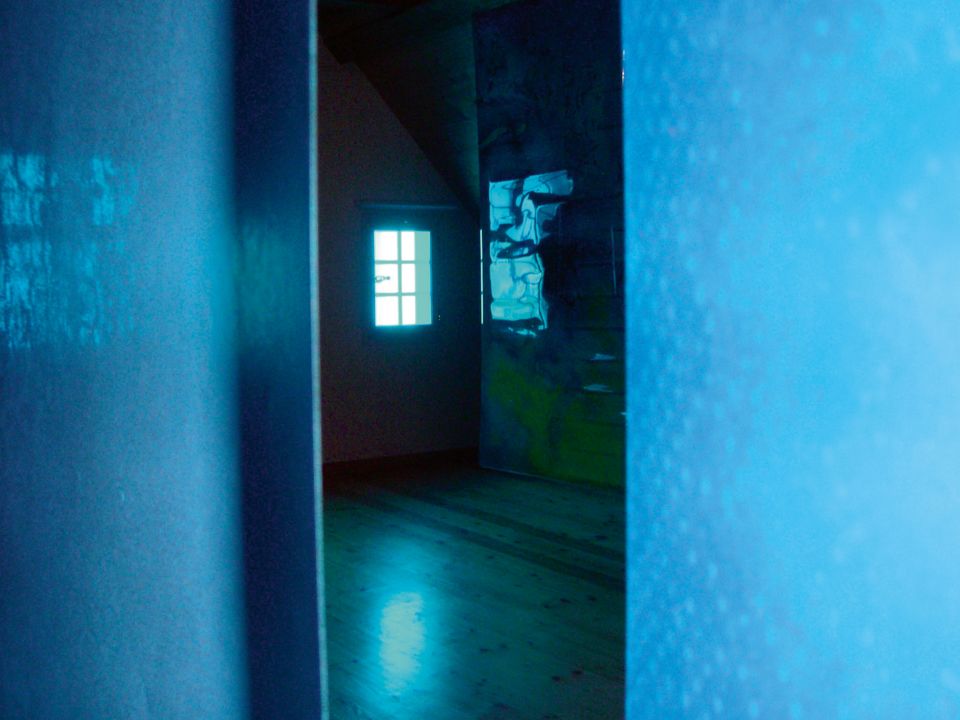Weiterlesen Die Bedeutung des Paragrafen 129 a, Terroristische Vereinigung
© ProLitteris, Josef Estermann
Strafverfolgung und politische Verstösse im Kanton Luzern
von Josef Estermann
Inhalt
1. Auseinandersetzung um die Strafbarkeit des Cannabiskonsums 1997/98
2. Petition zur Legalisierung des Cannabiskonsums
3. Bericht der Petitionskommission des Grossen Rates des Kantons Luzern zur Petition der DroLeg Regionalgruppe Luzern
4. Zur strafrechtlichen und polizeilichen Behandlung von Betäubungsmitteldelikten, insbesondere des Haschischkonsums im Kanton Luzern
5. Stellungnahme der Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern zur Petition vom 24. September 1997 der DroLeg Regionalgruppe Luzern, unter Wertung des Beschlusses des Grossen Rates vom 25. November 1997, diese Petition ohne weitere Folgen zur Kenntnis zu nehmen
6. Die zur Zeit geltenden Regelungen und Empfehlungen für Betroffene
1. Die Auseinandersetzung um die Strafbarkeit des Cannabiskonsums 1997/98
Die Diskussion um die Strafbarkeit des Konsums von Betäubungsmitteln wurde nach der Zeit der Alkoholprohibition seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts kontrovers und heftig diskutiert (1,2). Nach der Einführung der Strafbarkeit des Konsums im Jahre 1975 stieg die Zahl der Verzeigungen und Verurteilungen massiv an, und zwar nach einigen Unterbrüchen kontinuierlich. Mit der DroLeg-Initiative zur Legalisierung des Konsums und der kurz vorher durch Volksentscheid abgelehnten Initiative «Jugend ohne Drogen», die ein Abgabeverbot für Opiate und mehr Repression durchsetzen wollte, gewann die Kontroverse an Schärfe. Mit der nicht immer gut fundierten Trennung zwischen «harten» und «weichen» Drogen, wobei Haschisch zu den «weichen», Heroin Kokain und Alkohol zu den «harten» gerechnet wird, rückte zeitweise auch die Frage der differenzierten Sanktionierung, also der Straffreiheit des Konsums und der Distribution der sogenannten «weichen» Drogen in den Vordergrund. In der Rechtswirklichkeit lässt sich eine solche bereits feststellen, ist doch die Zahl der polizeilichen Verzeigungen wegen Cannabiskonsums gleich gross wie diejenige wegen Heroinkonsums, obwohl die Zahl der Cannabiskonsumierenden mehr als zehn mal so hoch ist wie die Zahl der Heroinkonsumierenden. (3,4) Als erster Schritt zu einer Rückkehr in die Zeiten vor der Prohibition griff die DroLeg-Regionalgruppe Luzern zu dem Mittel der Petition, um den Kanton Luzern zu einer Standesinitiative zur Legalisierung von Cannabis-Produkten zun bewegen.
Die Petitionskommission des Grossen Rates des Kantons Luzern (Parlament) lehnte die Petition mit falschen Tatsachenbehauptungen ab (Kenntnisnahme ohne weitere Folgen) und verletzte damit die Volksrechte. Das Parlament (Grosser Rat) folgte dem Antrag der Petitionskommission diskussionslos.
Inhalt und Schicksal dieser politischen Initiative ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Quellen und Literatur
1 Schultz, Hans: Die strafrechtliche Behandlung der Betäubungsmittel, in: Schweizerische Juristen-Zeitung, Heft 5, 68. Jahrgang, 1. August 1972, S. 229-238.
2 Bertschi, Marcel: Strafloser Konsum von Betäubungsmitteln? In Schweizerische Juristen-Zeitung, Heft 24, 68. Jahrgang, 15. Dezember 1972, S. 369-374.
3. Koller, Christophe: La consommation de drogues dans les prisons suisses. Résultats d’une enquête par interviews réalisée en 1993, in: Joachim Nelles und Andreas Fuhrer (Hrsg.): Harm Reduction in Prison. Risikominderung im Gefängnis, Lang, Bern 1997.
4. Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (SFA): Alkohol, Tabak und illegale Drogen in der Schweiz 1994-1996, SFA, Lausanne 1997.
2. Die Petition «Hanf – Legalisierung JETZT!» der DroLeg Regionalgruppe Luzern
Am 24. September 1997 reichte die DroLeg Regionalgruppe Luzern, Postfach 4928, 6002 Luzern eine von über 2500 Personen unterschriebene Petition an den Grossen Rat des Kantons Luzern ein.
Sie hat folgenden Wortlaut:
Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition fordern:
– Der Kanton Luzern bekennt Farbe und verlangt mit einer Standesinitiative die Legalisierung von Cannabis-Produkten. Entsprechende Standesinitiativen wurden bereits von den Kantonen Zürich und Baselland verabschiedet.
– Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten verzichtet der Kanton Luzern auf die polizeiliche und juristische Verfolgung von Menschen wegen Cannabisprodukten (Opportunitätsprinzip).
Auf dem Unterschriftenbogen sind folgende Argumente abgedruckt:
Das Cannabis-Verbot ist kontraproduktiv.
Die Verfolgung der Konsumierenden von Cannabis ist unsinnig und teuer. 1994 wurden über 20000 Verzeigungen wegen Haschischkonsums getätigt. Das Ziel, Cannabis-Konsum zu verhindern, erreicht das Verbot jedoch keineswegs. Hingegen werden sozial integrierte Personen in die Illegalität gedrängt und gezwungen, einen zum Teil gewalttätigen Schwarzmarkt zu unterstützen.
Cannabis ist weniger gefährlich als Alkoholprohibition
Gemäss Bundesgericht gefährdet Cannabis selbst beim Konsum von grösseren Mengen die Gesundheit nicht. Cannabis hat noch niemanden getötet, während in der Schweiz jeder zwanzigste Todesfall auf Alkohol zurückzuführen ist. Eine derart widersprüchliche Gesetzgebung macht die Prävention unglaubwürdig.
Das Verbot erschwert die Nutzung von Hanf als Gebrauchs-, Produktions- und Heilmittel.
Hanf ist ein wertvoller Rohstoff. In der Schweiz kann Hanf nicht nur angebaut werden, er hat auch Tradition: Der Bundesbrief 1291 wurde auf Hanfpapier geschrieben! Für unsere landwirtschaftliche Bevölkerung wäre der ökologische Hanf-Anbau eine höchst willkommene neue Einnahmequelle. Auch in der Medizin ist Cannabis wertvoll – als schmerzlinderndes und entspannendes Mittel hilft Cannabis krebskranken Menschen.
3. Bericht der Petitionskommission und Beschluss des Grossen Rates des Kantons Luzern zur Petition der DroLeg Regionalgruppe Luzern
Sitzung vom 25. November 1997, Protokoll Nr. 529.
Die Petitionskommission des Grossen Rates, des Parlaments des Kantons Luzern stand unter dem Vorsitz von Alex Bruckert, Liberale Partei des Kantons Luzern.
Die Petitionskommission unterbreitet dem Grossen Rat zu der am 20. Oktober 1997 eröffneten Petition der Dro-Leg Regionalgruppe Luzern folgenden Bericht vom 3. November 1997:
Am 24. September 1997 reichte die DroLeg Regionalgruppe Luzern bei der Staatskanzlei eine Petition zur «Hanf-Legalisierung» zuhanden des Grossen Rates ein. Darin fordern die Petentinnen und Petenten den Grossen Rat auf, mit einer Standesinitiative die Legalisierung von Cannabis zu verlangen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf die polizeiliche und juristische Verfolgung von Menschen wegen Cannabisprodukten zu verzichten. Die Petition wurde von rund 2500 Personen unterschrieben.
An ihrer Sitzung vom 3. November 1997 hat sich die Petitionskommission mit dieser Petition befasst. Im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz) ist auch die Frage der Behandlung der Cannabisprodukte Gegenstand der Revisionsarbeiten. Die Expertenkommission hat sich ganz knapp gegen eine Legalisierung der Cannabisprodukte ausgesprochen. (1) Und dies nicht so sehr aus fachlichen Gründen, sondern vielmehr aus politischen, da noch zu viele Probleme und Unsicherheiten vorhanden seien (Fragen der Marktbearbeitung, Monopole auf der Angebotsseite, Stellung gegenüber dem Ausland mit restriktiver Regelung etc.).
Die Petitionskommission teilt diese Meinung und ist überdies der Ansicht, dass dieses Anliegen nicht auf kantonaler Ebene behandelt werden muss. Wie erwähnt läuft zur Zeit die Revision des Betäubungsmittelgesetzes und in absehbarer Zeit wird die Volksinitiative für eine vernünftige Drogenpolitik zur Abstimmung kommen. Darin wird unter anderem Straffreiheit für den Konsum von Betäubungsmitteln sowie deren Anbau, Besitz und Erwerb für den Eigenbedarf verlangt. Aus diesem Grund erachtet die Petitionskommission den gegenwärtigen Zeitpunkt für die Einreichung einer Standesinitiative als ungeeignet.
Zur zweiten Forderung der Petentinnen und Petenten nimmt die Petitionskommission wie folgt Stellung:
Gemäss Betäubungsmittelgesetz ist der Besitz, Handel und Konsum von Betäubungsmitteln strafbar. Betäubungsmittel sind abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain und Cannabis. Der Kanton kann die Bundesgesetzgebung nicht unterlaufen und ist somit verpflichtet, die Strafverfolgung bei Betäubungsmitteldelikten von Amtes wegen anzuheben. Allerdings kann in leichten Fällen das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Das bedeutet in der Praxis, dass der Besitz oder Konsum von Cannabisprodukten durch die Polizei geahndet werden muss, dass der Amtsstatthalter (2) das Verfahren wegen Geringfügigkeit jedoch einstellen kann. Eine Nachfrage hat ergeben, dass diese Verfahren in der Regel eingestellt werden. Aus den dargelegten Gründen kann der Kanton Luzern auf die polizeiliche Verfolgung deshalb nicht verzichten. Der Spielraum liegt einzig in der «juristischen Verfolgung» und wird von den zuständigen Behörden auch genützt.
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt die Petitionskommission dem Grossen Rat, die Petition der DroLeg Regionalgruppe sei ohne weitere Folgen zur Kenntnis zu nehmen.
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag der Petitionskommission diskussionslos zu. Von der Petition der DroLeg Regionalgruppe Luzern wird ohne weitere Folgen Kenntnis genommen.
Für den getreuen Auszug, Der Staatsschreiber (3)
Anmerkungen und Kommentare
1 Der Beschlusstext bezieht sich hier zwar nicht explizit, aber mit einiger Sicherheit auf folgende Quelle: Bericht der Expertenkommission für die Revision des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 1951 an die Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes des Inneren, Bundesamt für Gesundheitswesen, Bern, Februar 1996 (Kommission Schild). Dort ist zu lesen: «Es existieren aber auch eine Anzahl von Unsicherheiten und Problemen, die es nach Ansicht einer Mehrheit der Kommission als nicht angezeigt erscheinen lassen, Cannabisprodukte abweichend von den übrigen gesetzlich geregelten Betäubungsmitteln zu behandeln.» (S.55) Umgekehrt spricht sie sich jedoch für die Straffreiheit des Konsums aus: «Wenn nämlich die Strafbefreiung des Konsums und seiner Vorbereitungshandlungen realisiert wird, stellt sich durchaus die Frage, ob speziell für den Handel mit Cannabisprodukten eine von den übrigen Betäubungsmitteln abweichende Regelung einzuführen ist, die zum Beispiel auch den Anbau zum Verkauf erlauben würde. Der Anbau zur Deckung des Eigenbedarfs hingegen ist nach Ansicht der Kommission eine Beschaffungshandlung und fällt somit unter die straflosen Vorbereitungshandlungen.» (S. 54) Sowie: «Der illegale Konsum von Betäubungsmitteln ist nicht länger mit Strafe zu verfolgen. Eine klare Mehrheit der Kommission¨ist zudem der Auffassung, dass auch die Vorbereitungshandlungen zum Eigenkonsum straffrei bleiben sollten» (S. 57)
2 Der Amtsstatthalter verfügt gemäss Luzerner Recht über Funktionen, die anderswo die Bezirksanwälte wahrnehmen. Er verfügt aber auch über Funktionen eines Verhörrichters und kann Sanktionen bis hin zu kurzen Freiheitsstrafen in eigener Kompetenz verhängen.
3 Mitteilung an DroLeg Gruppe Luzern, z.h. Reto Gmür, Postfach 4928, 6002 Luzern, und an das Justizdepartement am 27. November 1997.
4. Zur strafrechtlichen und polizeilichen Behandlung von Betäubungsmitteldelikten, insbesondere des Haschischkonsums im Kanton Luzern
4.1 Die Petition zur strafrechtlichen Verfolgung des Cannabiskonsums im Kanton Luzern
Am 24. September 1997 reichte die DroLeg Regionalgruppe Luzern eine Petition mit über 2500 Unterschriften ein, die vom Grossen Rat verlangte, er möge eine Standesinitiative deponieren, um den Bundesgesetzgeber zu veranlassen, den Konsum von Cannabisprodukten nicht mehr unter Strafe zu stellen. Die zweite Forderung ging dahin, der Kanton Luzern möge im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf die polizeiliche und juristische Verfolgung von Menschen wegen Cannabisprodukten verzichten.
Am 25. November 1997 lehnte der Grosse Rat auf Antrag der Petitionskommission (Sitzung vom 3. November 1997) die Petition ab, das heisst, er nahm sie ohne weitere Folgen zur Kenntnis. Die zweite Forderung, die unter Anwendung des Opportunitätsprinzip die Einstellung von Verfahren wegen Cannabiskonsums verlangt, wurde durch die Kommission mit folgendem Hinweis bedacht: «… dass der Besitz oder Konsum von Cannabisprodukten durch die Polizei geahndet werden muss, dass der Amtsstatthalter das Verfahren wegen Geringfügigkeit jedoch einstellen kann. Eine Nachfrage hat ergeben, dass diese Verfahren in der Regel eingestellt werden.»
4.2 Die Situation in der Schweiz
Seit 1975 ist der Konsum von Betäubungsmitteln gemäss BetmG strafbar. Dieser Norm wird seither mit allem Nachdruck Geltung verschafft. Die juristische Begründung dieser Strafnorm ist und war umstritten. (8) Mehrere europäische Länder kennen die Strafbarkeit des Konsums nicht. (9) Im Jahre 1994 wurden 40’378 Verzeigungen registriert, davon 32’032 wegen blossen Konsums. (1) Die Verzeigungen betrafen etwas mehr als 25’000 Personen. (2) Im selben Jahr ergingen 23’537 Entscheide, davon endeten nur 1820 ohne Sanktion. (4) Im Strafregister eingetragen wurden 9426 Urteile, 35 % wegen blossen Konsums, 45% wegen Handels und Konsums und 20% wegen Handels ohne gleichzeitigem Konsum.
4.3 Situation in Luzern, Daten des Zeitraums 1994-1997
Im Jahre 1997 (1996, 1995, 1994) wurden im Kanton Luzern 2 (9, 2,1) kg Marihuana, 1 (3, 133, 4) kg Haschisch und 82 (84, 41, 505) Hanfpflanzen beschlagnahmt. Es erfolgten 903 (955, 1109, 560) Verzeigungen wegen Konsums von Betäubungsmitteln, 302 (171, 94, 59) wegen Marihuana, 291 (450, 597, 313) wegen Haschisch und 5 (4, 4, 2) wegen Haschischöl, dagegen 37 (62, 88, 63) wegen Handels mit diesen Substanzen (inklusive Fälle mit gleichzeitiger Konsumverzeigung). (1) Somit betrug im Jahre 1997 bei den polizeilichen Interventionen wegen Hanfprodukten das Verhältnis Händler zu Konsumierenden 1 zu 16.
Es wurden also fast zwanzig mal mehr Konsumierende verfolgt als Händler.
Im Strafregister eingetragen wurden im Jahre 1995 aus dem Kanton Luzern 47 Verurteilungen wegen blassem Konsum, 139 Verurteilungen wegen Konsums und gleichzeitigem Handel sowie 59 Verurteilungen wegen Handels ohne gleichzeitigen Konsum, also insgesamt 245 Verurteilungen.
Daten zu den nicht eingetragenen Verurteilungen (Nicht Eintragung ist bei Konsumdelikten die Regel) sind für das Jahr 1994 publiziert. (4) Von den über 1000 Luzerner 1994er Entscheiden zum BetmG bezogen sich 610 auf blossen Konsum, 343 auf Konsum und gleichzeitigen Handel und 58 auf blossen Handel. 162 Entscheide lauteten auf Freiheitsstrafe, 23 auf strafrechtliche Massnahmen, 462 auf Busse und 365 auf einen Verweis. Somit wurden 1994 fast 300 Konsumdelikte mit teilweise empfindlichen Strafen belegt. Einstellungen wurden keine registriert, doch bleibt die Möglichkeit, dass diese äusserst seltenen Fälle nicht an das Bundesamt für Polizeiwesen gemeldet wurden und dort somit nur Kenntnis über das eröffnete Verfahren, nicht aber über die erfolgte Einstellung besteht.
Leider sind keine Daten über die in diesen Entscheiden inkriminierten Substanzen publiziert. Der Anteil der bestraften Haschisch- und Marihuanakonsumierenden ist jedoch bedeutend, unter anderem deshalb, weil auch der grösste Teil der Konsumverzeigungen aufgrund von Hanfprodukten erfolgte.
Die polizeilichen Verzeigungen lassen sich statistisch nicht ohne Vorsicht mit den Verurteilungen in Verbindung bringen. Urteile werden einige Zeit nach der Verzeigung gefällt und fassen häufig mehrere Verzeigungen zusammen. (2,6)
4.4 Qualitatives Material
Cannabiskonsumierende in Luzern berichten über etwelche polizeiliche Kontakte mit Sanktionsfolgen. Es herrscht jedoch die Meinung vor, dass in erster Linie Heroinkonsumierende betroffen seien und in letzter Zeit auch zunehmend «Raver» mit Methamphetaminerfahrungen (Exstasy etc.). Cannabiskonsumierende empfinden sich nicht als Hauptzielscheibe polizeilicher Drogenarbeit. Da jedoch Cannabiskonsum verboten ist, fühlen sie sich diskriminiert und verheimlichen in der Regel ihren Gebrauch. Es handelt sich in der Regel um integrierte Bürgerinnen und Bürger, die bei Bekanntwerden ihrer Konsumgewohnheit negative Folgen für ihr Berufs- und Privatleben befürchten.
4.5 Beurteilung
In den vergangenen Jahren hat sich die Verfolgung des Cannabiskonsums in Luzern nicht vermindert. Er steht, was die polizeiliche Anzeigenarbeit angeht, neben dem Heroinkonsum, nach wie vor im Vordergrund. (2, 6, 7) In den neunziger Jahren Jahren wurde diese Arbeit intensiviert und verursacht steigende Kosten. (3,7) Im Bereich der Strafjustiz erfolgte nur eine leichte Untergewichtung des Haschischkonsums im Vergleich etwa zu Heroin und Kokain. Sanktionen sind beim Vorliegen einer polizeilichen Verzeigung jedoch die Regel und nicht die Ausnahme. In der Regel werden in Luzern bei Konsumdelikten Bussen durch den Amtsstatthalter verhängt. Die Höhe der Bussen liegen bei Konsumdelikten allermeistens unter 500 Franken. Die Praxis im Kanton Luzern ist beispielsweise etwas milder als diejenige in den Kantonen Bern, Waadt und Aargau, jedoch härter als diejenige in Zürich, Basel und Genf.
Falsch ist die Behauptung der Petitionskommission, der Konsum von Cannabisprodukten würde strafrechtlich kaum mehr verfolgt. Diese Desinformationspolitik führt dazu, dass sich das Opportunitätsprinzip faktisch gegen die Konsumierenden richtet anstatt gegen die Händler. Der Willkür werden Tür und Tor geöffnet und die Volksrechte verletzt.
Grafik: Polizeiliche Verzeigungen wegen Verstosses gegen das BetmG im Kanton Luzern, 1974-1997
Grafik: Verzeigungen wegen Hanfkonsums in der Schweiz seit 1974
Anmerkungen und Literatur
1 Bundesamt für Polizeiwesen: Schweizerische Betäubungsmittelstatistik, Jahrgänge 1984 bis 1997, Bern, 1985ff.
2 Bundesamt für Statistik: Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Zeitreihen zu Verzeigungen, Strafurteilen und Strafvollzug 1974-1994, Bern, 1995
3 Bundesamt für Statistik: Die Kosten der Drogenrepression, Bern 1995
4 Bundesamt für Statistik: Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Ergebnisse zweier Sondererhebungen 1991 und 1994, Bern, 1997
5 Bundesamt für Statistik: BFS aktuell. Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Verzeigungen, Verurteilungen, Strafvollzug 1995 und 1996, Bern, 1997
6 Estermann, Josef: Sozialepidemiologie des Drogenkonsums, Berlin 1996
7 Estermann, Josef (Hg.): Auswirkungen der Drogenrepression, Luzern 1997
8 Schultz, Hans: Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes 1975: Gründe, Ergebnisse, Auswirkungen. In: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 113/1975, S. 273-278
9 Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (SFA): Alkohol, Tabak und illegale Drogen in der Schweiz 1994-1996, im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheitswesen, Lausanne 1997.
5. Demokratische Juristinnen und Juristen Luzern, Sektion der Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz: Stellungnahme zur Petition vom 24. September 1997 der DroLeg Regionalgruppe Luzern, unter Wertung des Beschlusses des Grossen Rates vom 25. November 1997, diese Petition ohne weitere Folgen zur Kenntnis zu nehmen.
I
Am 24. September 1997 reichte die Regionalgruppe DroLeg Luzern eine Petition mit über 2500 Unterschriften ein.
II
Die Petition verlangte vom Stand Luzern, er möge durch eine Standesinitiative den Bundesgesetzgeber veranlassen, den Konsum von Cannabisprodukten nicht mehr unter Strafe zu stellen. Ähnliche Standesinitiativen in den Kantonen Bern, Basel und Zürich sind bereits ergriffen oder werden vorbereitet.
III
Die zweite Forderung der Petition verlangte, der Kanton Luzern möge im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten auf die polizeiliche und juristische Verfolgung von Menschen wegen Cannabisprodukten verzichten.
IV
Am 25. November 1997 nahm der Grosse Rat auf Antrag der Petitionskommission (Sitzung vom 3. November 1997) die Petition lediglich ohne weitere Folgen zur Kenntnis, was einer faktischen Ablehnung der Forderung der Petentinnen und Petenten gleichkommt. Die zweite Forderung, die sinngemäss eine praktisch dekriminalisierende Anwendung des Opportunitätsprinzips verlangt, wurde mit dem Hinweis abgelehnt, «dass der Besitz oder Konsum von Cannabisprodukten durch die Polizei geahndet werden muss, dass der Amtsstatthalter das Verfahren wegen Geringfügigkeit jedoch einstellen kann. Eine Nachfrage hat ergeben, dass diese Verfahren in der Regel eingestellt werden».
V
Mit der Einlassung zur Forderung nach einer Standesinitiative (siehe II) scheint die Kommission wohl von der Annahme auszugehen, dass die Expertenkommission zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes die Straffreiheit des Konsums ablehnen würde. Dies trifft nicht zu (vgl. Bericht der Expertenkommission, 1996, S. 49ff und S. 54ff). Weiter argumentiert die Kommission, dass dieses Anliegen nicht auf kantonaler Ebene behandelt werden muss. Dies trifft insofern zu, als dass es sich beim Betäubungsmittelgesetz um Bundesrecht handelt. Die Standesinitiative ist jedoch ein Rechtsinstitut, das auf Bundesrecht abzielt. So sind auch die bereits hängigen Standesinitiativen Basel-Stadt, Zürich und Bern zu verstehen. Zutreffend ist, dass die sogenannte DroLeg Initiative, die ebenfalls Straffreiheit des Konsums verlangt, seit mehreren Jahren hängig ist und noch kein Termin für die Volksabstimmung festgesetzt wurde. Dieser Umstand hat jedoch andere Kantone nicht davon abgehalten, entsprchende Standesinitiativen zu lancieren.
VI
Mit der Einlassung zur Forderung der konsequenten Anwendung des Opportunitätsprinzips im Sinne einer Freistellung von Strafe bei Hanfkonsum (siehe III) geht die Kommission davon aus, dass die Strafverfolgung bei Betäubungsmitteldelikten von Amtes wegen anzuheben sei und damit die Anwendung des Opportunitätsprinzips gegenüber dem Legalitätsprinzip ein Unterlaufen von Bundesrecht darstellen würde. Dies trifft nicht zu. So sieht beispielsweise die neue Strafprozessordnung des Kantons Zug (§§1, 6 und 13) die Anwendung des Opportunitätsprinzips vor. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt stellt blosse Konsumverfahren in der Regel gemäss Bestimmungen der dortigen Strafprozessordnung folgenlos ein. Der procureur general des Kantons Genf lässt prinzipiell keine blossen Konsumverfahren zur gerichtlichen Aburteilung zu. Diese partiellen Anwendungen des Opportunitätsprinzips gelten nicht als bundesrechtswidrig. Auch die Anweisung an die Polizei kräfte, bestimmte Konsumformen nicht mehr zu verfolgen, da kein Sanktionsentscheid der vorgeordneten Behörde zu erwarten wäre, ist nicht bundesrechtswidrig.
Nicht zutreffend ist, dass die Amtsstatthalterinnen und Amtsstatthalter Verfahren einstellen oder von Strafe absehen würde. Gemäss. einer Sondererhebung des Bundesamtes für Statistik erfolgten durch die Amtsstatthalter in Luzern im Jahre 1994 lediglich 36% der entsprechenden Erledigungen durch Verweise, die ebenfalls eine Sanktion darstellen. (BFS, 1997, S. 37)
Entscheide ohne jegliche Sanktion, wie sie gemäss Art. 19a, Ziff. 2, 1. Satz BetmG möglich wären, konnten 1994 aufgrund der Meldungen aus Luzern an die Zentralstelle für Betäubungsmittel des Bundesamtes für Polizeiwesen in Bern, an die sämtliche eröffneten Verfahren gemeldet werden müssen (Art. 29 Ziff. 3 BetmG), keine festgestellt werden. Eine Nachfrage bei der Amtsstatthalterschaft ergab, dass dies der aktuellen Praxis nach wie vor entspricht. Unter den 1012 Entscheiden des Jahres 1994 lauteten 16% auf Freiheitsstrafen, 2% auf Massnahmen und 46% auf Bussen. Zu beachten sind die sehr seltenen Fälle von Freisprüchen oder Einstellungen des Verfahrens mangels Beweisen.
Aus den Ausführungen ergibt sich, dass dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit bei den Konsumierenden und in der Bevölkerung in keiner Art und Weise Rechnung getragen wird. Der unzutreffende Hinweis auf die Anwendung des Opportunitätsprinzips auf der Stufe Amtsstatthalter könnte dazu führen, dass Gelegenheitskonsumierende und Personen, die Cannabisprodukte aus medizinischen Gründen zu sich nehmen, davon ausgehen, dass sie keine Sanktion treffen würde. Dies ist aber im Kanton Luzern nachgewiesenermassen nicht der Fall. Insofern können auch die Verteidigungsrechte der Betroffenen eingeschränkt sein, da der Rechtsirrtum im Bereich des Strafrechts nicht geschützt wird. Eine solche Einschränkung entspricht nicht dem Konzept des Rechtsstaats: Rechtssicherheit geht vor, der Grosse Rat als gesetzgebendes Organ dürfte im Beschluss vom 25. November 1997 nicht den falschen Eindruck der Sanktionslosigkeit des Betäubungsmittelkonsums erwecken.
VII Schlussfolgerungen
Die Empfehlung der Petitionskommission mag in keiner Hinsicht zu befriedigen. Sie beruht auf falschen Tatsachen und einer juristisch falschen Einschätzung des Opportunitätsprinzips. Bedenkenswert erscheint, dass mit der ablehnenden Antwort den demokratischen Rechten und Ansprüchen der über 2500 Petentinnen und Petenten nicht adäquat Rechnung getragen wird. Ein Rückkommen auf den Entscheid des Grossen Rates wäre angezeigt.
Grafik: BetmG-Verzeigungen und Urteile im Kanton Luzern, 1994
Anmerkungen und Literatur
1. Bundesamt für Gesundheitswesen: Daten und Fakten zur Drogenpolitik des Bundes, 6. Repression, S. 24f, Bern Mai 1997.
2. Bundesamt für Polizeiwesen: Schweizerische Betäubungsmittelstatistik, Jahrgänge 1993 bis 1997, Bern 1994ff.
3. Bundesamt für Statistik: Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Ergebnisse zweier Sondererhebungen 1991 und 1994, Bern 1997.
4. Kommission Schild, Bundesamt für Gesundheitswesen: Bericht der Expertenkommission für die Revision des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 1951 an die Vorsteherin des Eidgenössischen Departementes des Innern, Bern 1995.
5. Hans Schultz: Die Revision des Betäubungsmittelgesetzes 1975: Gründe, Ergebnisse, Auswirkungen. In: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 113/1995, S. 273-278.
6. Schweizerische Fachstelle für Alkohol und andere Drogenprobleme (SFA): Alkohol, Tabak und illegale Drogen in der Schweiz 1994-1996, im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheitswesen, Lausanne 1997.
6 Die zur Zeit geltenden Regelungen
Bundesgesetz über die Betäubungsmittel, AS 1952 241, SR 812.121, Stand vom 1. Januar 1998 (BetmG)
Verordnung über die Betäubungsmittel, SR 812.121.1, (BetmV)
Verordnungen des Bundesamtes für Gesundheitswesen und deren Anhänge, SR 812.121.2
Art. 1, Abs. 1 und 3 BetmG
Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der Wirkungstypen Morphin, Kokain, Cannabis.
Den Betäubungsmitteln im Sinne dieses Gesetzes sind gleichgestellt: a) Halluzinogene … b) zentrale Stimulantien … c) weitere Stoffe, denen … ähnliche Wirkung innewohnt …
Art. 8, Abs. 1 BetmG
Die folgenden Betäubungsmittel dürfen nicht angebaut, eingeführt, hergestellt oder in Verkehr gebracht werden:
a. Rauchopium und die bei seiner Herstellung oder seinem Gebrauch entstehenden Rückstände;
b. Diazetylmorphin und seine Salze;
c. Halluzinogene wie Lysergid (LSD 25)
d. Hanfkraut zur Betäubungsmittelgewinnung und das Harz seiner Drüsenhaare (Haschisch).
Kommentar: Der Anbau etc. von Hanfkraut ist erlaubt, sofern dies nicht der Betäubungsmittelgewinnung dient. Haschisch hingegen ist eine verbotene Substanz. Wissenschaftliche Forschung bleibt mit Bewilligung des Bundesamtes für alle Substanzen möglich. In den Anhängen 1 bis 5 sind weit über 200 Substanzen dem BetmG unterstellt.
Art. 8, Abs. 5 BetmG
Das Bundesamt für Gesundheitswesen kann, wenn kein internationales Abkommen entgegensteht, Ausnahmebewilligungen erteilen, soweit die Betäubungsmittel … der wissenschaftlichen Forschung oder zu Bekämpfungsmassnahmen dienen oder die Stoffe nach Absatz 1 Buchstaben b und c für eine beschränkte medizinische Anwendung benützt werden.
Kommentar: Die beschränkte medizinische Anwendung ist nur für Heroin und Halluzinogene wie LSD erlaubt, nicht aber für Haschisch oder Hanfkraut. Die psychoaktive Substanz des Hanfkrautes, das Tetrahydrocannabinol (THC), wird im Anhang 2 zur Betäubungsmittelverordnung unter dem Titel Halluzinogene aufgeführt, Ausnahmebewilligung und beschränkte medizinische Anwendung sind also möglich. Solche Inkonsistenzen sind typisch für das schlecht redigierte Betäubungsmittelgesetz und seine Verordnungen.
Art. 19 BetmG
1. Wer unbefugt alkaloidhaltige Pflanzen· oder Hanfkraut zur Gewinnung von Betäubungsmitteln anbaut,
wer unbefugt Betäubungsmittel herstellt, auszieht, umwandelt oder verarbeitet,
wer sie unbefugt lagert, versendet, befördert, einführt, ausführt oder durchführt,
wer sie unbefugt anbietet, verteilt, verkauft, vermittelt, verschafft, verordnet, in Verkehr bringt oder abgibt,
wer sie unbefugt besitzt, aufbewahrt, kauft oder sonstwie erlangt, wer hierzu Anstalten trifft,
wer den unerlaubten Verkehr mit Betäubungsmitteln finanziert oder seine Finanzierung vermittelt,
wer öffentlich zum Betäubungsmittelkonsum auffordert oder öffentlich Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum von Betäubungsmitteln bekannt gibt,
wird, wenn er die Tat vorsätzlich begeht, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter einem Jahr, womit eine Busse bis zu 1 Million Franken verbunden werden kann.
2. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter
a. weiss oder annehmen muss, dass sich die Widerhandlung auf eine Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen kann;
b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur Ausübung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs zusammengefunden hat;
c. durch gewerbsmässigen Handel einen grossen Umsatz oder erheblichen Gewinn erzielt.
3. Werden die Widerhandlungen nach Ziffer 1 fahrlässig began gen, so ist die Strafe Gefängnis bis zu einem Jahr, Haft oder Busse.
Kommentar: Der Artikel 19 BetmG regelt die Strafdrohung bei Vergehen und bei sogenannten schweren Fällen (Verbrechen), nicht aber den Konsum.
Art. 19a BetmG
1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Haft oder Busse bestraft.
Kommentar: Hier handelt es sich um die sogenannte Privilegierung des Konsums. Der Konsum ist eine Ordnungswidrigkeit. Er kann ähnlich wie die meisten Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz höchstens mit sehr kurzen Freiheitsstrafen geahndet werden. Ersatzfreiheitsstrafen bei Nichtbezahlen der Busse sind häufig.
2. In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt werden oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann eine Verwarnung ausgesprochen werden.
Kommentar: Leichte Fälle des Konsums können straffrei gestellt werden, müssen aber nicht. Die Behörde oder der Beamte kann mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken handeln.
3. Untersteht oder unterzieht sich der Täter wegen Konsums von Betäubungsmitteln einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung, so kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden. Das Strafverfahren wird durchgeführt, wenn sich der Täter der Betreuung oder der Behandlung entzieht.
4. Ist der Täter von Betäubungsmitteln abhängig, so kann ihn der Richter in eine Heilanstalt einweisen. Artikel 44 des Schweizer Strafgesetzbuches gilt sinngemäss.
Kommentar: Art. 44 StGB ermöglicht die langjährige Internierung der Abhängigen: Die Gesamtdauer der Massnahme bei mehrfacher Rückversetzung darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 19b BetmG
Wer nur den eigenen Konsum vorbereitet oder Betäubungsmittel zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar, wenn es sich um kleine Mengen handelt.
Kommentar: Diese Norm ist praktisch bedeutungslos, sie legt nur fest, dass der Versuch desn Konsums kleiner Mengen nicht strafbar ist.
Art. 19c BetmG
Wer jemand zum unbefugten Betäubungsmittelkonsum vorsätzlich anstiftet oder anzustiften versucht, wird mit Haft oder Busse bestraft.
Kommentar: Es geht immer um den unbefugten Konsum beziehungsweise den unbefugten Umgang. Falls die Substanz verschrieben wurde oder etwa in einem erlaubten wissenschaftlichen Versuch verwendet wird, ist dies nicht strafbar. Die gleiche Substanz ist in diesem Fall meistens – per definitionem – ein Medikament und keine illegale Droge.
Art. 23 BetmG
Begeht ein mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragter Beamter vorsätzlich eine Widerhandlung nach den Artikeln 19-22, so wird die Strafe angemessen erhöht.
Der Beamte, der zu Ermittlungszwecken selber oder durch einen andern ein Angebot von Betäubungsmitteln annimmt oder Betäubungsmittel persönlich oder durch einen andern entgegennimmt, bleibt straflos, auch wenn er seine Identität und Funktion nicht bekanntgibt.
Kommentar: Hier wird festgelegt, dass der verdeckte Fahnder für Tatbestände straffrei bleibt, für die normale Konsumierende bestraft werden. Es handelt sich um das Ermittlungsprivileg, das es Beamten ermöglicht, jederzeit mit grösseren Mengen Rauschgift umzugehen, ohne ein Strafverfahren zu riskieren. Dies macht Korruption besonders attraktiv.
Art. 28 BetmG
Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.
Sämtliche Urteile, Strafbescheide und Einstellungsbeschlüsse sind sofort nach ihrem Erlass in vollständiger Ausfertigung der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesrates mitzuteilen.
Kommentar: Bei der Bundesanwaltschaft gehen zur Zeit jährlich knapp 30’000 Akten über Personen ein. Sie werden elektronisch bearbeitet und existieren als Datenbank so lange, wie es die Bundesanwaltschaft wünscht. Dies gilt selbstverständlich auch für blosse Hanfkonsumierende und auch für von Strafe freigesprochene Personen.
Art. 29 BetmG
Das Bundesamt für Polizeiwesen ist die schweizerische Zentralstelle für die Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs.
Es hat bei der Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs durch Behörden anderer Staaten im Rahmen der bestehenden Rechtshilfevorschriften und der Rechtsübung mitzuwirken. Es sammelt die Unterlagen, die geeignet sind, Widerhandlungen gegen dieses Gesetz zu verhindern und die Verfolgung Fehlbarer zu erleichtern. In Erfüllung dieser Aufgaben steht es in Verbindung mit den entsprechenden Dienstzweigen der Bundesverwaltung (Bundesamt für Gesundheitswesen, Oberzolldirektion, Generaldirektion PTT), mit den Polizeibehörden der Kantone, mit den Zentralstellen der anderen Länder und der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation INTERPOL.
Für die Vornahme von Beweiserhebungen bei der Leistung von internationaler Rechtshilfe in Betäubungsmittelstrafsachen sind die entsprechenden Bestimmungen des Bundesstrafrechtspflegegesetzes anwendbar.
Die Kantone haben der Zentralstelle über jede wegen Widerhandlung gegen dieses Gesetz eingeleitete Strafverfolgung rechtzeitig Mitteilung zu machen.
Kommentar: Jede Person, gegen die ein Verfahren eröffnet wird, wird registriert, unabhängig von ihrer Schuld oder Unschuld. Es handelt sich dabei um rund 40’000 Personendaten pro Jahr. Polizeistellen haben auf diese Daten Zugriff.
Allgemeine Verhaltensempfehlung
Die Behörden müssen die Straftat beweisen. Am einfachsten für sie ist ein Geständnis. Es kann aber niemand zu einer Aussage gezwungen werden. Es ist nicht von Vorteil und nicht zu empfehlen, eine Aussage zu machen oder etwas zuzugeben, bevor nicht der Rat einer Juristin oder eines befreundeten Rechtskundigen eingeholt wurde. Viele Verurteilungen sind einzig und allein aufgrund unüberlegter Aussagen von Beschuldigten möglich.
Weitergehende Literatur bei Orlux AG erhältlich:
Heike Zurhold: Drogenkarrieren von Frauen im Spiegel ihrer Lebensgeschichten. Eine Qualitative Vergleichsstudie differenter Entwicklungsverläufe opiatgebrauchender Frauen, 1993, 227 Seiten, Fr. 35.-
Ute Herrmann: Frauen, HIV-Infektionen und AIDS, 1995, 104 Seiten, Fr. 18.-
Simone Rônez, Josef Estermann: Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Drogues et droit penal en Suisse. Zeitreihen zu Verzeigungen, Strafurteilen und Strafvollzug 1974-1994, BFS 1995, 87 Seiten, Fr. 12.-
Heiner Busch: Grenzenlose Polizei. Neue Grenzen und polizeiliche Zusammenarbeit in Europa, 1995, 435 Seiten, Fr. 42.-
Wolfgang Schneider: Risiko Cannabis? Bedingungen und Auswirkungen eines kontrollierten, sozial-integrierten Gebrauchs von Haschisch und Marihuana, 1995, 161 Seiten, Fr. 30.-
Arthur Schroers: Szenealltag im Kontaktcafe. Eine sozial ökologische Analyse akzeptanzorientierter Drogenarbeit, 1995, 211 Seiten, Fr. 34.-
akzept e.V. (Hg.): Drogen ohne Grenzen. Entwicklung und Probleme akzeptierender Drogenpolitik und Drogenhilfe in Europa, 1995, 356 Seiten, Fr. 42.-
Drogen und Strafrecht in der Schweiz. Zeitreihen zu Verzeigungen, Strafurteilen und Strafvollzug, 1974-1994, 87 Seiten
Wolfgang Schneider: Der gesellschaftliche Drogenkult. Essays zur Entzauberung von Drogenmythen in der Drogenhilfe, Drogenforschung und Drogenpolitik, 1996, 130 Seiten, Fr. 25.-
Brigitta Kolte: «Was für einen Sinn hat es, immer nüchtern zu sein?». Wie Frauen Cannabis konsumieren, 1996, 119 Seiten, Fr. 25.-
Josef Estermann, Ute Herrmann, Daniela Hügi, Bruno Nydegger: Sozialepidemiologie des Drogenkonsums. Zu Prävalenz und Inzidenz des Heroin- und Kokaingebrauchs und dessen polizeiliche Verfolgung, 1996, 195 Seiten, Fr. 32.-
Josef Estermann (Hrsg.): Auswirkungen der Drogenrepression. Illegale Drogen: Konsum, Handel, Markt und Prohibition, 1997, 268 Seiten, Fr. 38.-
Wolfgang Schneider (Hrsg.): Brennpunkte akzeptanzorientierter Drogenarbeit. Frauenarbeit – Exstasy – Sekundärprävention – Methadon – Qualitätssicherung – Drogenpolitik, 1997, 163 Seiten, Fr. 30.-
SFA: Alkohol, Tabak und illegale Drogen in der Schweiz 1994-1996, 1997, 220 Seiten.
Hans-Peter von Aarburg: Heroin-Dampf-Scheiben-Wirbel. Eine kulturantropologische und ethnopsychoanalytische Studie des Folienrauchens in Zürich, 1998.